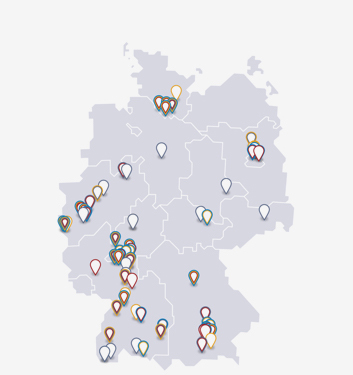„Wir kommen jetzt zu einer Medizin der Ursachen“
Bei beschleunigter Zulassung werden neuen Studientypen eingesetzt. Wie sie funktionieren, erklärt IGES-Chef Professor Bertram Häussler.

Ärzte Zeitung: Herr Professor Häussler, bei beschleunigter Zulassung werden neue Typen klinischer Studien eingesetzt: adaptive Studien, Umbrella- oder Basket-Studien. Was unterscheidet diese Studien von konventionellen RCTs?
Häussler: Zunächst zum Hintergrund: In den letzten Jahren sind verstärkt Arzneimittel entwickelt worden, die am Ende des Lebens eingesetzt werden. Wenn diese Arzneimittel ein Potenzial zeigen, dann möchten die Zulassungsbehörden diese Medikamente nicht durch sehr lang laufende Studienkonzepte den betroffenen Patienten vorenthalten. Zur Frage: Der konventionelle RCT folgt einem einmal festgelegten Protokoll, es sei denn, Zwischenauswertungen zeigen sich unvertretbare Risiken oder ein unerwarteter Erfolg.
Dann erfolgt ein Abbruch aus ethischen Gründen durch die Ethikkommission. Bei den adaptiven Studien schreibt man ins Protokoll, dass an bestimmten Punkten Zwischenanalysen stattfinden. Mit der Konsequenz, die Therapie zu modifizieren oder auf bestimmte Patientengruppen zu konzentrieren, die besonders profitieren. Diese Designs sind aber älter als die beschleunigten Zulassungsverfahren.
Man hat also Erfahrung damit?
Ja, seit Anfang der 2000er-Jahre. Gleichwohl: Der RCT ist der mit weitem Abstand häufigste Studientyp.
Und wie definiert man Basket-Studien?
Das ist die interessanteste Modifikation zum RCT. Ein RCT ist eine krankheitsbezogene Studie. Es wird geprüft, ob für eine bestimmte Gruppe von Patienten mit einer bestimmten Krankheit die alternative Therapie besser ist als die bisher bekannte. Bei der Basket-Studie wird nicht mehr die Krankheit zugrunde gelegt, sondern eine Mutation oder Krankheitsneigung, von der man weiß, dass sie krank macht.
Man wechselt also vom Organbezug einer Krankheit auf eine Mutation, die identisch in mehreren Organen stattfinden kann?
Genau. Im Grunde genommen von der Oberfläche einer Krankheit zu ihrem Kern. Was eine Krankheit am Ende ausmacht, ist eine Vielzahl von Faktoren und Symptomen. Aber gerade bei Krebs finden zelluläre Stoffwechselprozesse statt, die durch einen genetischen Mechanismus angestoßen werden. Dass dies präzise erkannt werden kann, zeigt den Reifegrad der Wissenschaft.
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, zum Beispiel diagnostische Marker?
Ja, das kann man nur machen, wenn man mit Hilfe von Gensequenzierungen bei den in Frage kommenden Patienten eindeutig feststellen kann, ob sie die entsprechende Mutation aufweisen. Das ist zunehmend möglich, weil man in der Krebsforschung einen Zusammenhang zwischen gestörten Signalwegen und den Script-Variationen in der DNA feststellen kann. Da gibt es öffentliche Bibliotheken mit Assoziationsstudien, die zeigen, wo beispielsweise ein Melanom überall seine Mutationen haben kann. Damit kann man Patienten mit bestimmten Mutationen genau identifizieren. Und solche Treiber-Mutationen können prinzipiell in sehr vielen Geweben auftreten und zu Krebs führen – das muss nicht mehr organspezifisch sein.
Bedeutet das, dass man dann bei weitem nicht mehr so viele Probanden benötigt, um einen Therapieeffekt zu bestätigen? Und schneller zum Ziel gelangt.
Das ist zumindest wahrscheinlich. Aber Effekte können auch durch unterschiedliche Bedingungen im Gesamtorgankomplex abgeschwächt werden. Aber wir kommen hier zu einer Medizin der Ursachen, und deshalb ist sie organ- und krankheitsübergreifend. Eine weitere Besonderheit ist, dass es bei einer Basket-Studie in der Regel keine Kontrollgruppe gibt – es ist allerdings keine Besonderheit bei Patienten, bei denen alle bisherigen Therapien versagt haben. Da wäre es unsinnig und unethisch, eine Kontrollgruppe zu bilden.
Sind die Studien in der Lage, Auskunft über mögliche Risiken zu machen?
Ja, aber zunächst nur über häufigere Risiken, abhängig von der Anzahl der bis zur Zulassung in Studien behandelten Patienten. Allerdings geht es dabei in der Regel um todkranke Patienten ohne andere Therapieoptionen, sodass man Risiken bei neuen Therapien anders bewertet. Aber es gibt natürlich ein Risiko-Management.
Dieser Text entstand in Zusammenarbeit mit der Ärzte Zeitung.