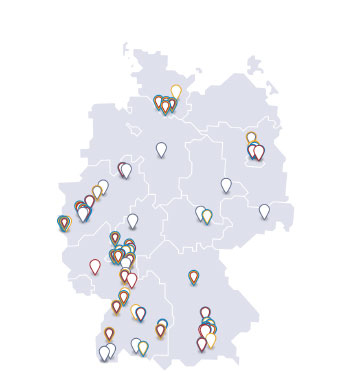„Die Spreu vom Weizen trennen“ - wie nützlich ist ein nicht belegter Zusatznutzen?
Die Spreu vom Weizen trennen. Dies ist wohl die häufigste Umschreibung des AMNOG-Verfahrens, wo neue Arzneimittel mit und ohne belegten Zusatznutzen identifiziert und dementsprechend bepreist werden sollen. In der aktuellen Reformdebatte wird diese einfache Differenzierungsformel gerade wiederbelebt, um beim nicht belegten Zusatznutzen noch härter vorzugehen.

So elegant die biblische Redewendung klingt, so irreführend ist sie jedoch bei der Nutzenbewertung. Denn ursprünglich sollte die Spreu im „nie erlöschendem Feuer verbrennen“ (Matthäus 3,12), das Gute und Verwertbare also vom Bösen und Nutzlosen getrennt werden. Was suggeriert aber die Redewendung für das AMNOG? Bedeutet das, dass 42 Prozent der seit 2011 bewerteten Arzneimittel ohne belegten Zusatznutzen nutz- und wertlos sind? Mitnichten. Gerade für diese Kategorie sind der Kontext und der Blick in die Praxis entscheidend. Warum?
Erstens, ein nicht belegter Zusatznutzen bedeutet nicht, dass kein Nutzen vorliegt. Eine positive Nutzen-Risiko-Abwägung eines Arzneimittels wird zuvor im Rahmen der Zulassung bereits geprüft. Im AMNOG steht sie nicht zur Debatte.
Zweitens, ein nicht belegter Zusatznutzen steht immer in Relation zu einer zweckmäßigen Vergleichstherapie, also zum aktuellen Therapiestandard. Jedes als gleich gut bewertete Arzneimittel erweitert zumindest das Spektrum der verfügbaren Therapieoptionen im Versorgungsalltag. Relevant ist dies vor allem, da Arzneimittel nicht bei jedem Betroffenen dauerhaft wirksam oder gut verträglich sind. Zugleich sollen Medikamente ohne Mehr an Nutzen gemäß den AMNOG-Regularien aber auch nicht mehr kosten.
Drittens erfolgt die Feststellung eines nicht belegten Zusatznutzens in den allermeisten Fällen dadurch, dass die verfügbare Evidenz aus internationalen Studien nicht den spezifischen Bewertungsanforderungen in Deutschland entspricht und daher überhaupt nicht in der Nutzenbewertung heranzogen wird. Eine inhaltliche Abwägung von positiven und negativen Therapieeffekten findet in diesen Fällen nicht statt (Rasch 2023). So zum Beispiel bei einer abweichenden Vergleichstherapie oder auch, weil die zuvor vorgegebene zweckmäßige Vergleichstherapie kurzfristig geändert wurde (Grau Morenilla et al. 2024). So aber auch bei vielen Zulassungsstudien in pädiatrischen oder sehr seltenen Populationen, für deren Durchführung spezifische Limitationen gelten, dies im Rahmen der Nutzenbewertung jedoch ohne systematische Würdigung bleibt. Und selbst bei berücksichtigten Studien kann ein nicht belegter Zusatznutzen aus spezifischen Besonderheiten der jeweiligen Therapien oder Therapielinien resultieren, so zum Beispiel durch die eingeschränkte Akzeptanz bestimmter Endpunkte.
Viertens spiegelt ein nicht belegter Zusatznutzen kaum den realen Stellenwert eines Arzneimittels in den medizinischen Leitlinien und in der Versorgung wider. So stellt der G-BA selbst in einigen Fällen fest, dass ein Medikament trotz einer solchen Bewertung „eine relevante Therapieoption“ sein kann (G-BA 2024, 2024a). Oder der „hohe aktuelle Stellenwert in der klinischen Versorgung […] bedauerlicherweise nicht abgebildet werden“ kann, weil die Ergebnisse einer hochwertigen Studie „nicht mehr in das formale Bewertungsergebnis einfließen“ können (G-BA 2024e). Zudem kann auch mit einem nicht belegten Zusatznutzen ein Arzneimittel vom G-BA zur neuen zweckmäßigen Vergleichstherapie benannt werden. Begründet wird dies beispielhaft damit, dass es „bereits Eingang in die relevanten Leitlinienempfehlungen gefunden hat und sein Stellenwert in der Versorgungspraxis durch die wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens bekräftigt wurde“ (G-BA 2024b). Es zeigt sich insgesamt, dass für 35% der AMNOG-bewerteten Arzneimittel, die später zur zweckmäßigen Vergleichstherapie werden, zuvor kein Zusatznutzen anerkannt wurde. Ein AMNOG-Beschluss ist also kein Abbild der Versorgungsrealität.
Fünftens, ein nicht belegter Zusatznutzen in einer Erstbewertung oder einer Erstindikation kann später in einem großen Zusatznutzen münden, auch in der höchsten Kategorie: einem erheblichen Zusatznutzen. Dies war zuletzt beispielsweise in einem Verfahren aufgrund großer Vorteile beim krankheitsfreien Überleben sowie Gesamtüberleben in der Bewertung eines kurativen Therapieansatzes des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms der Fall (G-BA 2024c). Dies ist ein Beispiel dafür, welches enorme Potenzial für die Versorgung innovative Arzneimittel im Zeitverlauf entfalten können - wenn es die Rahmenbedingungen auch zu Beginn ermöglichen.
Sechstens können die Bewertungen der involvierten Institutionen sich durchaus unterscheiden. Wenn zum Beispiel das IQWiG die Studien und damit den Zusatznutzen nicht anerkannt hat, kann der G-BA im weiteren Verlauf zu einem zu einem anderen Ergebnis gelangen, ggf. sogar zu einem erheblichen Zusatznutzen (G-BA 2025). Wiederum kann eine medizinische Fachgesellschaft zu einer gänzlich anderen Beurteilung gelangen als der G-BA. Hier sei erneut auf das Beispiel einer frühen Therapie des nicht-kleinzelligen Lungenkarzinoms, für die seitens der European Society for Medical Oncology (ESMO) die höchstmögliche Bewertung einer kurativen onkologischen Therapie vergeben wurde, der G-BA jedoch keinen Zusatznutzen feststellen konnte (G-BA 2024d).
Insgesamt zeigen die oberen Punkte, dass hinter einem "nicht belegten" Zusatznutzen sich keine wertlose Spreu, sondern durchaus wichtige neue Therapieoptionen verbergen. Gerade hier ist mehr Augenmaß, Flexibilität und Berücksichtigung des Versorgungsbedarfs im AMNOG geboten.
Literatur:
G-BA (2024) Nutzenbewertungsverfahren zum Wirkstoff Midostaurin,
https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/nutzenbewertung/1012
G-BA (2024a) Nutzenbewertungsverfahren zum Wirkstoff Risdiplam,
https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/nutzenbewertung/995/
G-BA (2024b) Nutzenbewertungsverfahren zum Wirkstoff Bimekizumab,
https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/nutzenbewertung/1087/
G-BA (2024c) Nutzenbewertungsverfahren zum Wirkstoff Osimertinib,
https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/nutzenbewertung/1096/
G-BA (2024d) Nutzenbewertungsverfahren zum Wirkstoff Pembrolizumab,
https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/nutzenbewertung/1026/
G-BA (2024e) Pressemitteilung,
https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1184/
G-BA (2025) Nutzenbewertungsverfahren zum Wirkstoff Alectinib,
https://www.g-ba.de/bewertungsverfahren/nutzenbewertung/1100/
Grau Morenilla et al. (2024): „Nicht belegter Zusatznutzen durch späte Änderungen der zweckmäßigen Vergleichstherapie “, in „Monitor Versorgungsforschung“ (05/24), S. 40–45.
http://doi.org/10.24945/MVF.05.24.1866-0533.2668
Rasch (2023) „Die neuen „Leitplanken“ im AMNOG-Prozess“, in: „Monitor Versorgungsforschung“ (04/23), S. 40–44. http://doi.org/10.24945/MVF.04.23.1866-0533.2530
Dieser Text erschien zunächst als Namensbeitrag des vfa im Observer Gesundheit.