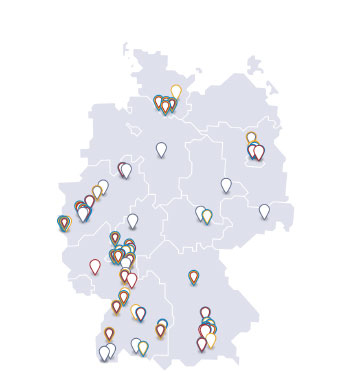Sichere Behandlung mit Medikamenten
Das perfekte Medikament macht jeden, der an der Krankheit leidet, gegen die es entwickelt wurde, in kurzer Zeit gesund. Es setzt nur an der Krankheit an und stört ansonsten körperliche und psychische Vorgänge nicht. Es lässt sich in seiner Wirksamkeit und Verträglichkeit durch nichts beeinflussen – nicht durch Essen, Getränke noch weitere Medikamente. Es wirkt bei Sportlern genauso wie bei Couch Potatoes. Seine Wirksamkeit und Verträglichkeit ist nicht beeinträchtigt, wenn einmal eine Einnahme vergessen wurde oder gleich zweimal erfolgt. Aber: So ein perfektes Medikament gibt es nicht! Was Pharmaforscher allerdings wiederum nicht davon abhält, diesem Ideal so nahe wie möglich zu kommen.

Wer Arzneimittel einnimmt, vertraut darauf, dass damit die Beschwerden gelindert, vielleicht sogar die Krankheit geheilt werden kann. Dieses Vertrauen ist berechtigt; denn Arzneimittel gehören zu den effektivsten therapeutischen Mitteln, die Ärzten heute zur Verfügung stehen. Allerdings greifen Arzneimittel in das komplexe Stoffwechselgeschehen des menschlichen Organismus ein - und das hat zwangsläufig mehr als einen Effekt. Zu den Wirkungen gehören erwünschte und unerwünschte. Die Anwendung von Arzneimitteln birgt deshalb immer Chance und Risiko zugleich. Die folgenden Seiten sollen erläutern, wie es zu unerwünschten Arzneimittelwirkungen kommt, was Pharmaforscher tun, um Medikamente möglichst sicher zu entwickeln und wie das System funktioniert, um aus problematischen Nebenwirkungen, die erstmals entdeckt werden, schnell Lehren für andere Patienten zu ziehen.
Es gibt verschiedene Gründe, warum Medikamente, die normalerweise gut vertragen werden, bei der konkreten Behandlung eines bestimmten Patienten Probleme bereiten können. Meist hat es mit einer der folgenden, allen Apothekern geläufigen Grundregeln zu tun:
- Die Dosis macht das Gift
- Keine Wirkung ohne Nebenwirkung
- Kein Mensch ist wie der andere
Bei allen diesen drei Aspekten gibt es aber auch Wege, das Risiko bei der Behandlung so weit wie möglich zu reduzieren.
Die Dosis macht das Gift
Im 16. Jahrhundert schrieb der Arzt Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, genannt Paracelsus (1493-1541): „Von Anbeginn (...) ist das Exempel der Arznei gesetzt worden, nach welchem wir Ärzte uns richten sollen. Da aber jedes Ding auf der Welt Verderben und Heil in sich trägt, macht es nur die Dosis, ob es zum Gift wird." Die Schlussfolgerungen aus dieser meist zu „Die Dosis macht das Gift!" verkürzten Einsicht waren zu ihrer Zeit revolutionär: Giftigkeit ist keine Eigenschaft, die eine Substanz entweder hat oder nicht hat. Vielmehr kann jede Substanz bei einem Menschen giftig wirken, wenn sie im Übermaß zugeführt wird.
Dosis und Spiegel
Unter Dosis verstehen Mediziner und Apotheker die Menge des Arzneistoffs, die dem Körper zugeführt wird.
Nach der Einnahme gelangt der Wirkstoff aus einem Medikament in der Regel in den Blutkreislauf, wo er sich gleichmäßig verteilt. Dann enthält jeder Milliliter Blut eine bestimmte Konzentration des Wirkstoffs; diese Konzentration heißt auch Wirkstoffspiegel.
Dies bestätigte auch der britische Arzt William Withering (1741-1799), der als erster die Wirkung des Roten Fingerhuts Digitalis purpurea gegen die Wassersucht – die Ansammlung von Flüssigkeit in Armen, Beinen und Bauch bei Patienten mit Herzschwäche – systematisch untersuchte. „Gifte in kleinen Dosen sind die besten Medizinen", schrieb er, „und nützliche Medizinen in zu hohen Dosen sind giftig.“
Praxis: Wie man eine überhöhte Dosierung vermeidet
Die Packungsbeilage liefert klare Angaben, wie viel man von einem Medikament einnehmen darf. Diese Angaben sollte man ohne Rücksprache mit dem Arzt keinesfalls überschreiten.
Für einige Dosis-kritische Medikamente wurden Kontrollen entwickelt (z.B. der Blutzuckertest für Insulin-bedürftige Diabetiker oder der INR-Test für Anwender von bestimmten Gerinnungshemmern). An diesen Tests sollte man nicht sparen.
Gerade bei Schmerzmitteln ist man leicht geneigt, eine Tablette nach der anderen zu nehmen, wenn keine befriedigende Linderung eintritt. Überschreitet man deutlich die angegebene Höchstdosis, bringt man sich durch mögliche Nebenwirkungen in Gefahr, ohne große Aussicht, dass dieses Mittel doch noch gut wirkt. Stattdessen sollte man lieber mit dem Arzt oder Apotheker darüber sprechen, ob ein anderes oder ein stärkeres Schmerzmittel nötig ist.
Keine Wirkung ohne Nebenwirkung
Kaum ein Wirkstoff schafft es, im Körper wirklich nur in den Krankheitsprozess einzugreifen und sonst nichts „anzutasten“. Vielmehr erzielt ein Wirkstoff praktisch immer noch weitere Wirkungen. Dies können positive Begleitwirkungen sein: Einige Frauen haben erlebt, dass die Antibaby-Pille auch ihre Akne mildert; Blutdrucksenker vom Betablocker-Typ mindern auch das Risiko eines Migräne-Anfalls.
Häufiger als vorteilhafte treten nachteilige Begleiterscheinungen auf, die sogenannten Nebenwirkungen (von Spezialisten für Arzneimittelsicherheit auch „unerwünschte Arzneimittelwirkungen", UAW, genannt). Unter Apothekern kursiert der Spruch „Was keine Nebenwirkungen hat, hat auch keine Hauptwirkung“. Solange Nebenwirkungen nur geringfügig ausfallen, bleiben sie meist unbemerkt. Sie können aber – je nach Dosierung und Konstitution des Patienten – auch starke Symptome hervorrufen, die mitunter sogar gefährlich werden. Manche Nebenwirkungen sind körperlicher Art wie etwa Hautausschläge oder Herzrasen, andere können psychischer Art sein, sich etwa in Form von Alpträumen äußern.
Forscher streben bei der Entwicklung eines neuen Medikaments an, Nebenwirkungen durch die Gestaltung des Wirkstoffs und die Art der Verabreichung möglichst auszuschließen. Lassen sie sich aber nicht völlig ausschließen, streben die Forscher an, dass Nebenwirkungen zumindest erst bei höheren Konzentrationen des Wirkstoffs auftreten als die Hauptwirkung. Das Intervall zwischen der für die erwünschte Wirkung des Medikaments mindestens nötigen Dosis und der maximal tolerierbaren Dosis, bevor schädliche Effekte auftreten, nennen Arzneimittelexperten die „therapeutische Breite" eines Wirkstoffs. Innerhalb dieses Bereichs sollten die Konzentrationen des Wirkstoffs zur Behandlung liegen. Pharma-Unternehmen sehen allerdings zusätzlich noch einen Sicherheitsabstand zwischen der tatsächlichen Obergrenze der therapeutischen Breite und der angegebenen Höchstdosis vor.
Die therapeutische Breite von Wirkstoffen aus der Fingerhut-Pflanze (Digitalis) ist sehr gering; denn sie wirken bei Patienten unter Umständen bereits schädlich, wenn die therapeutische Dosis nur um das Anderthalbfache überschritten wird – mit anderen Worten: Wenn ein Patient versehentlich zwei statt einer Tablette eingenommen hat, hat er sich bereits eine problematische Überdosis zugeführt! Bei Acetylsalicylsäure (ASS), einem in vielen Schmerzmitteln verwendeten Wirkstoff, sind Schäden dagegen erst beim fünf- bis zehnfachen der normalen Behandlungsdosis zu erwarten, Lebensgefahr besteht erst bei 30- bis 60-facher Überdosierung.
Lange Zeit galt die therapeutische Breite als das ausschlaggebende Kriterium bei der Beurteilung der Sicherheit. Substanzen, die auch bei massiver Überdosierung nicht zu Schäden beim Patienten führten, galten als unbedenklich. Man darf allerdings nicht vergessen, dass es außer rasch eintretenden Nebenwirkungen auch solche gibt, die sich erst nach Monate langem Dauergebrauch eines Medikaments einstellen. Deshalb müssen Medikamente für den Dauergebrauch sorgfältig auch auf mögliche Langzeiteffekte untersucht werden.
 Viele Wirkstoffe können vom Blut aus in die Muttermilch übergehen. Deshalb sollten stillende Mütter vor jeder Medikamentenanwendung mit dem Arzt oder Apotheker sprechen.Auch muss man die besondere Situation von schwangeren oder stillenden Frauen berücksichtigen. Hier besteht die Möglichkeit, dass der Wirkstoff aus einem eingenommenen Medikament auch ins ungeborene Kind gelangt oder von einem Säugling mit der Muttermilch aufgenommen wird. Bei ungeborenen Kindern oder Säuglingen kann ein Wirkstoff ganz andere Wirkungen haben als bei einer erwachsenen Frau, etwa Missbildungen oder Stoffwechselstörungen hervorrufen. Deshalb sind die meisten Medikamente nicht für schwangere Frauen und stillende Mütter zugelassen. Andere allerdings schon: So sollen schwangere Diabetikerinnen unbedingt unvermindert an ihrer Insulintherapie festhalten, weil andernfalls die Bauchspeicheldrüse des ungeborenen Kindes für die Mutter mitarbeiten muss. Ausführliche Informationen zu diesem Thema bietet das Webangebot www.embryotox.de des Berliner Klinikums Charité.
Viele Wirkstoffe können vom Blut aus in die Muttermilch übergehen. Deshalb sollten stillende Mütter vor jeder Medikamentenanwendung mit dem Arzt oder Apotheker sprechen.Auch muss man die besondere Situation von schwangeren oder stillenden Frauen berücksichtigen. Hier besteht die Möglichkeit, dass der Wirkstoff aus einem eingenommenen Medikament auch ins ungeborene Kind gelangt oder von einem Säugling mit der Muttermilch aufgenommen wird. Bei ungeborenen Kindern oder Säuglingen kann ein Wirkstoff ganz andere Wirkungen haben als bei einer erwachsenen Frau, etwa Missbildungen oder Stoffwechselstörungen hervorrufen. Deshalb sind die meisten Medikamente nicht für schwangere Frauen und stillende Mütter zugelassen. Andere allerdings schon: So sollen schwangere Diabetikerinnen unbedingt unvermindert an ihrer Insulintherapie festhalten, weil andernfalls die Bauchspeicheldrüse des ungeborenen Kindes für die Mutter mitarbeiten muss. Ausführliche Informationen zu diesem Thema bietet das Webangebot www.embryotox.de des Berliner Klinikums Charité.
 Formel von Thalidomid, dem Wirkstoff von ConterganContergan
Formel von Thalidomid, dem Wirkstoff von ConterganContergan
Der bekannteste Fall eines Medikaments, das bei Ungeborenen Missbildungen hervorruft, ist das Contergan-Desaster Ende der 1950er Jahre. Das Medikament Contergan mit dem Wirkstoff Thalidomid war ein Schlafmittel, das als risikoarm galt und deshalb auch von schwangeren Frauen eingenommen wurde. Bei der Einnahme in bestimmten Schwangerschaftswochen führt es jedoch zu schweren Missbildungen bei den Kindern, insbesondere fehlenden oder verkürzten Armen und Beinen. Bis das Arzneimittel als Ursache erkannt und 1961 vom Markt genommen wurde, waren bereits 6.000 Kinder missgebildet zur Welt gekommen.
Pharmaforscher haben Thalidomid Ende der 1960er Jahre noch einmal Sicherheitstests unterworfen, wie sie mittlerweile zum Pflichtprogramm bei jeder Medikamentenentwicklung gehörten. Dabei zeigte sich, dass die mittlerweile dafür entwickelten Tierversuche zuverlässig die Gefährlichkeit der Substanz für die Embryonalentwicklung anzeigten. Hätte man Thalidomid also erst später entdeckt und untersucht, wäre seine Anwendung von vornherein nur in Verbindung mit strikter Verhütung in Erwägung gezogen worden, und nur für schwere und anders nicht gut behandelbare Krankheiten. Eine Zulassung als Schlafmittel wäre sicher nicht in Betracht gekommen.
Mittlerweile ist wieder ein Thalidomid-haltiges Medikament auf dem Markt. Es dient aber nicht als Schlafmittel, sondern zur Behandlung des Multiplen Myeloms, einer Art Leukämie, die fast nur bei älteren Patienten auftritt. Zudem darf das Medikament nur eingesetzt werden, wenn streng sichergestellt wird, dass keine Schwangerschaft auftreten kann.
Unternehmen und Behörden haben die Art, wie Medikamente entwickelt und erprobt werden, aufgrund der Contergan-Katastrophe wesentlich verändert. So sind heute eine Reihe von Tierversuchen zur Überprüfung eines Wirkstoffs Pflicht, mit denen sich Contergan-artige Wirkungen zuverlässig erkennen lassen.
 Nicht einmal eineiige Zwillinge reagieren auf das gleiche Medikament immer gleich.Kein Mensch ist wie der andere
Nicht einmal eineiige Zwillinge reagieren auf das gleiche Medikament immer gleich.Kein Mensch ist wie der andere
Keine zwei Menschen sind genau gleich. Meist unterscheiden sie sich schon deutlich in ihrem Gewicht, dem Umfang ihrer Fettpolster, ihrem Trainingszustand, Geschlecht und anderen Dingen. Selbst eineiige Zwillinge, die praktisch identische Erbanlagen haben, sind nicht vollkommen gleich, weil durch unterschiedliche Lebensumstände Organe in unterschiedlicher Weise Schaden erleiden und die Erbanlagen unterschiedlich umgesetzt werden können.
Alle genannten Aspekte, in denen sich Menschen unterscheiden, können beeinflussen, ob und wie Medikamente im konkreten Einzelfall wirken. So steigt mit dem Gewicht das Volumen an Körpergewebe, in dem sich ein Wirkstoff verdünnt. Manche Wirkstoffe sickern mit Vorliebe in Fettgewebe ein, und im Blut bleibt dann nur eine deutlich verringerte Konzentration zurück. Bei einigen Medikamenten, bei denen es sehr darauf ankommt, dass die richtige Konzentration im Blut erreicht wird, wird deshalb die Dosis nicht nur als beispielsweise „eine Tablette täglich“ angegeben, vielmehr soll so viel von dem Medikament eingenommen werden, dass eine feste Milligramm-Menge Wirkstoff pro Kilogramm Körpergewicht erreicht wird. Ist auch das noch nicht genau genug, muss der Arzt nach den ersten Einnahmen nachmessen, ob der gewünschte Wirkstoffspiegel im Blut wirklich erreicht wurde. So wird das beispielsweise bei vielen Medikamenten gegen Epilepsie gehandhabt.
Die meisten Nebenwirkungen treten aber nicht bei jedem, nicht einmal bei jedem zweiten Patienten auf, sondern nur bei einer kleinen Minderheit. Um genauer angeben zu können, wie viele Patienten von einer Nebenwirkung betroffen sein könnten, einigte man sich auf eine Häufigkeitsskala, die auch in jeder Packungsbeilage zu einem Medikament enthalten ist (siehe Kasten).
 Die Häufigkeitseinteilung für Nebenwirkungen wird in allen Packungsbeilagen verwendet.Häufigkeitsangaben für Nebenwirkungen
Die Häufigkeitseinteilung für Nebenwirkungen wird in allen Packungsbeilagen verwendet.Häufigkeitsangaben für Nebenwirkungen
sehr häufig:
bei mehr als 1 von 10 Patienten
häufig:
bei mehr als 1 von 100, aber höchstens 10 von 100 Patienten
gelegentlich:
bei mehr als 1 von 1000, aber höchsten 10 von 1000 Patienten
selten:
bei mehr als 1 von 10.000, aber höchstens 10 von 10.000 Patienten
sehr selten:
bei höchstens 1 von 10.000 Patienten
Das bedeutet beispielsweise, dass eine gelegentlich auftretende Nebenwirkung bei
99 von 100 Patienten überhaupt nicht eintritt.
Diesen erheblichen Unterschieden in der Reaktion auf Medikamente ist auch mit einer präzisierten Dosierungsangabe nicht beizukommen. Stattdessen sind Ärzte und Patienten angehalten, auf das Auftreten von Nebenwirkungen zu achten und – sollte es dazu kommen – rasch zu entscheiden, ob diese tolerierbar sind, oder ob anders weiterbehandelt werden muss.
In einigen Fällen allerdings steht doch eine Möglichkeit bereit, mit der schon vor der ersten Einnahme festgestellt werden kann (und muss), ob der Patient ein infrage kommendes Medikament vertragen kann, ob es voraussichtlich bei ihm wirkt und welche Dosis hier die beste ist. Dazu dienen spezielle Tests, mit denen Gene oder Zellen untersucht werden. Dieses Vorgehen nennt man „personalisierte Medizin“. Es wird bereits bei mehr als 75 Medikamenten praktiziert (siehe www.vfa.de/personalisiert), und es dürften in den nächsten Jahren noch viele weitere dazu kommen. Denn heute wird bei der Entwicklung vieler neuer Medikamente begleitend zur Entwicklung nach den zuvor beschriebenenTestmöglichkeiten gesucht.
Leider gibt es auf absehbare Zeit nicht für alle Medikamente solche Tests, um verlässlich das Risiko für sehr selten auftretende unerwünschte Nebenwirkungen vor der Anwendung zu ermitteln. Das gilt insbesondere für Leberschäden, die manche Wirkstoffe aus immer noch ungeklärten Gründen bei einzelnen Patienten hervorrufen, während die Leber aller anderen Patienten den Wirkstoff einfach passieren lässt oder geordnet abbaut, ohne selbst darunter zu leiden. Leberschäden treten meist nur allmählich ein, lassen sich aber schon im Frühstadium an der Veränderung bestimmter Blutwerte ablesen. Für einige Medikamente muss deshalb der Arzt in regelmäßigen Abständen diese Leberwerte messen. Beobachtet er erstmals eine Erhöhung eines bestimmten Wertes, ist noch genug Zeit, das Medikament zu wechseln.
Auch ist bis heute nicht vorhersagbar, wer auf einen Wirkstoff allergisch reagiert. Ob dies geschieht, hat neben der angeborenen genetischen Ausstattung auch entscheidend mit der Lebensgeschichte zu tun, also damit, mit welchen Substanzen aus der Umwelt eine Person früher schon einmal in Kontakt gekommen ist. Glücklicherweise lassen sich solche allergischen Reaktionen in aller Regel gut behandeln, und sie treten meist auch nicht schon bei der ersten Einnahme eines Medikaments in voller Stärke auf. Bei ersten, milderen allergischen Beschwerden nach Medikamenteneinnahme kann man daher das Medikament wechseln, bevor es zu bleibenden Schäden kommt.
 Betablocker, ein Typ von Herzmedikamenten, können viele Infarktpatienten vor Folgeinfarkten schützen. Die verspätete Zulassung dieser Präparate in den USA hat vielen Menschen das Leben gekostet.Auch Risiken überschätzen ist gefährlich
Betablocker, ein Typ von Herzmedikamenten, können viele Infarktpatienten vor Folgeinfarkten schützen. Die verspätete Zulassung dieser Präparate in den USA hat vielen Menschen das Leben gekostet.Auch Risiken überschätzen ist gefährlich
Ein Arzneimittelrisiko zu unterschätzen, kann schlimme Folgen haben. Opfer sind allerdings auch zu beklagen, wenn Risiken überschätzt werden und Menschen deshalb unbehandelt bleiben. Das zeigt das folgende Beispiel: Betablocker sind Medikamente, die den Blutdruck senken und beispielsweise Herzinfarkten vorbeugen können. In Europa wurden sie seit Anfang der 1970er Jahre bei Herzerkrankungen eingesetzt. In den USA erlaubte die Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) die Verwendung von Betablockern zur Vorbeugung eines zweiten Herzinfarktes jedoch erst im Jahre 1981. Die FDA musste später zugeben, dass durch einen früheren Einsatz der Betablocker in den USA jährlich etwa 17.000 Menschen weniger vorzeitig gestorben wären.
Entscheidend: die Nutzen-Risiko-Abschätzung
Genügend Informationen vorausgesetzt, können Experten zu einer Bewertung der Risiken eines Arzneimittels kommen. Sie schätzen aus den zur Verfügung stehenden Daten ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine Nebenwirkung eintritt und wie schlimm diese ist. Dieses Risiko wägen sie dann gegen den Nutzen (Heilung, Krankheitsverzögerung, Linderung) ab, der von dem Arzneimittel zu erwarten ist. Dann lässt sich auf gesicherter Grundlage entscheiden, ob das Arzneimittel eingesetzt werden soll oder nicht. Geht es um lebensbedrohliche Krankheiten, wird in der Regel ein höheres Risiko für belastende Nebenwirkungen in Kauf genommen als bei weniger schweren Erkrankungen.
Nutzen und Risiko eines Arzneimittels: ein fiktives Beispiel
nach Klaus Heilmann „Medikament und Risiko", Stuttgart 1995
Von einer – nicht besonders gefährlichen – Krankheit ist bekannt, dass sie unbehandelt bei einem Prozent der Erkrankten zum Tode führt. Bei 100.000 Erkrankten ist also mit 1.000 Todesopfern zu rechnen.
Gegen diese Krankheit existiert ein wirksames Medikament, das allerdings auch Nebenwirkungen hat, die bei einem von 10.000 Behandelten zum Tode führen kann. Das heißt, von 100.000 behandelten Patienten sterben wahrscheinlich zehn Menschen an den Folgen der Behandlung.
Die Nutzen-Risiko-Abwägung spricht in diesem Fall eindeutig für das Medikament, denn durch die Behandlung können 990 Erkrankte vor vorzeitigem Tod bewahrt werden.